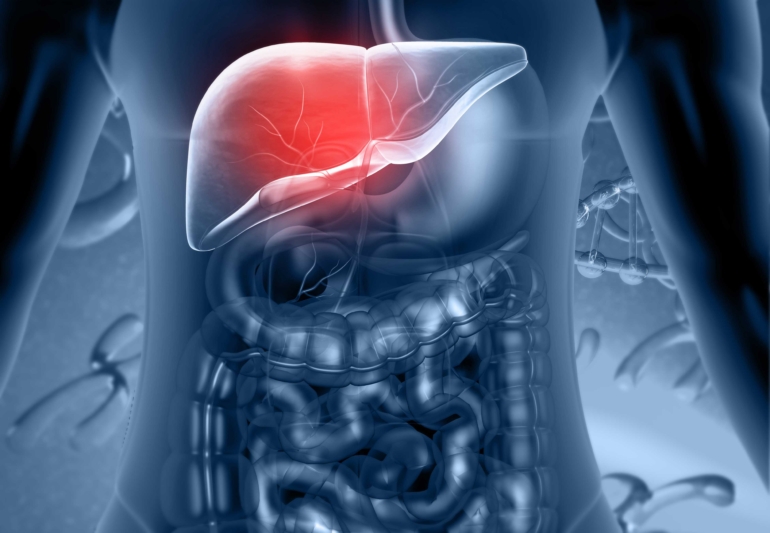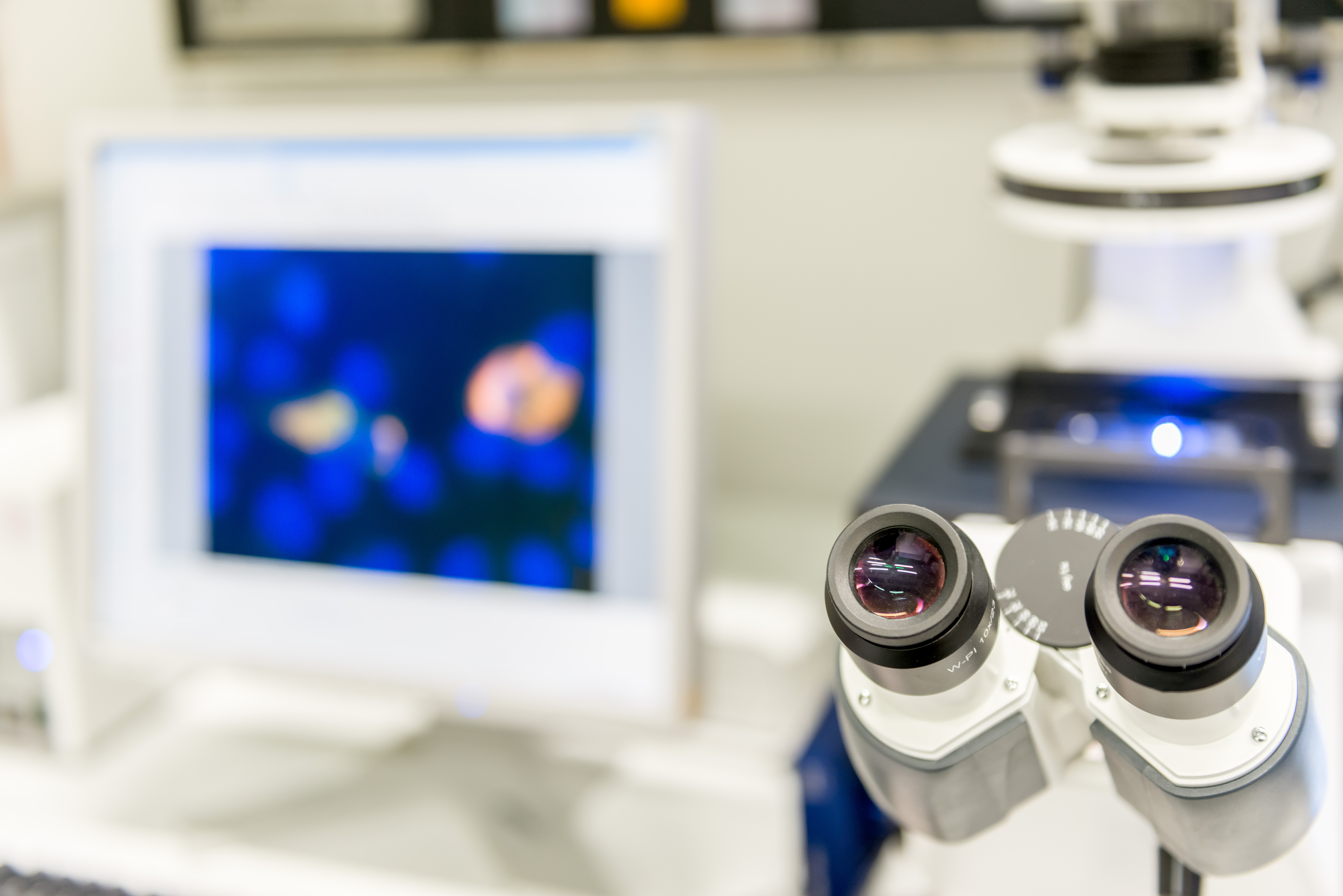Unter der Leitung von Dr. med. Kai Markus Schneider, Arzt und Wissenschaftler am Department of Microbiology an der University of Pennsylvania (USA) und Univ. Prof. Dr. med. Christian Trautwein, Direktor der Medizinischen Klinik III, konnten Forscher der Uniklinik RWTH Aachen, in Zusammenarbeit mit einem internationalen Team aus Ärzten und Wissenschaftlern, eine Rolle für mikrobiotaabhängige Veränderungen in der Gallensäurensynthese identifizieren, die den Verlauf der primär sklerosierenden Cholangitis (PSC) beeinflusst. Die Ergebnisse ihrer Arbeit „Gut microbiota depletion exacerbates cholestatic liver injury via loss of FXR signalling” wurden aktuell im international renommierten Wissenschaftsjournal Nature Metabolism mit Lena Candels als Erstautorin veröffentlicht.
Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine chronische cholestatische Lebererkrankung, deren Ursache weitestgehend unbekannt ist. Die therapeutischen Möglichkeiten sind daher leider sehr begrenzt, sodass ein Fortschreiten der Erkrankung heute nicht hinreichend aufgehalten werden kann. Es ist sehr erstaunlich, dass die PSC eine starke Assoziation mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zeigt. Welche Rolle dieser Verbindung zwischen Leber und Darm in der Krankheitsentstehung zukommt, ist Gegenstand der Forschung und ein Schwerpunkt experimenteller Forschungsarbeiten in der Klinik für Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik III; Direktor: Univ. Prof. Dr. med. Christian Trautwein) an der Uniklinik RWTH Aachen.
Patienten mit PSC zeigen Veränderungen der Darmmikrobiota und Gallensäurenkomposition. Der Beitrag dieser Veränderungen zur Entwicklung der Krankheit blieb bislang jedoch umstritten. Wie wir heute wissen, erfüllen Gallensäuren wichtige Funktionen, die weit über ihre gut bekannte Funktion in der Fettverdauung hinaus gehen; Gallensäuren sind Signalmoleküle, die spezifische Rezeptoren – wie zum Beispiel den Farnesoid X Rezeptor – aktivieren können. Interessanterweise beeinflusst die Darmmikrobiota durch spezifische mikrobielle Stoffwechselwege die Zusammensetzung der Gallensäuren und damit ihre Aktivität an spezifischen Gallensäurenrezeptoren. In einem genetischen PSC-Mausmodell zeigen die Wissenschaftler, dass der Verlust der Mikrobiota zu einer veränderten Gallensäurenzusammensetzung und damit reduzierter Aktivierung des FXR im Darm führt. Damit wird eine negative Feedback-Kontrolle der Gallensäure-Synthese abgeschaltet und es kommt zu erhöhten Gallensäure-Konzentrationen in der Leber, einer Störung der Gallengangsbarriere und folglich zu einer schweren Leberschädigung.
„Unsere präklinischen Daten zeigen die Bedeutung der mikrobiotaabhängigen Dynamik des Gallensäure-Stoffwechsels,“ erklärt Lena Candels, Doktorandin und Erstautorin der Forschungsarbeit. „Auch bei Patienten könnte der mikrobielle Gallensäurenmetabolismus die Aktivität des FXR-Signalwegs modulieren. Das möchten wir in zukünftigen Forschungsarbeiten untersuchen“, ergänzt Dr. med. Kai Markus Schneider. „Unsere aktuellen klinischen Forschungsergebnisse zeigen, dass die Gallensäurensynthese bei PSC Patienten – gemessen durch den Biomarker C4 – eine Vorhersage über den Krankheitsverlauf macht. Dieser Marker hat in der klinischen Praxis auch ein hohes Potential die Therapie von PSC-Patienten besser zu steuern.“ ![]()