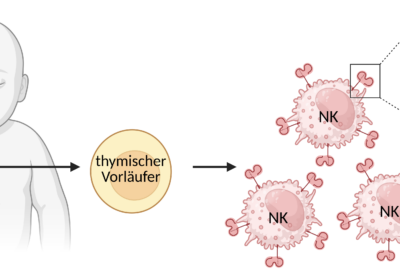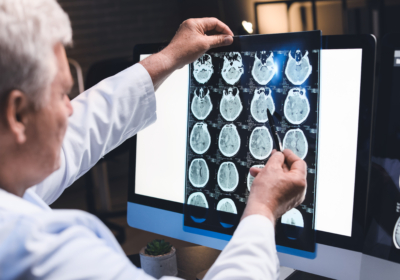Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Ute Habel
Was verbirgt sich hinter dem neuen Sonderforschungsbereich „Die Neuropsychobiologie von Aggression: Ein transdiagnostischer Ansatz für psychische Krankheiten“?
Prof. Habel: Beim SFB handelt es sich um ein großes Verbundprojekt mit zahlreichen interdisziplinären Partnern aus Mannheim, Heidelberg und Aachen, zusätzlich Mainz, Würzburg und Jülich. Wir untersuchen bei Mensch und Tier die neuropsychobiologischen Grundlagen von Aggression bei psychischen Störungen. Wir betrachten dabei mehrere Ebenen: Genetik, molekulare Mechanismen sowie hormonelle, neurale und damit verbundene Verhaltenssysteme. Der Transregio setzt sich zum Ziel, dabei multidimensional definierte Biosignaturen von Aggression bei psychischen Störungen zu identifizieren, die verschiedenen Formen von Aggression zugrunde liegen.
Biosignaturen kann man sich als bestimmte Muster verschiedener Parameter vorstellen, die mit der Symptomatik der Patienten und bestimmtem aggressivem Verhalten verbunden sind. Diese sollen dann verwendet werden, um maßgeschneiderte, Biomarker-gesteuerte Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln. Dabei untersuchen wir Aggression und die potentiellen Biosignaturen transdiagnostisch. Wir gehen davon aus, dass die identifizierten Biosignaturen transdiagnostisch sind und verschiedene Formen von Aggression über unterschiedliche psychische Störungen hinweg abbilden. Wir fokussieren uns besonders auf kognitiv-emotionale Prozesse bei Aggression, die ebenfalls durch Biosignaturen systematisch und dynamisch abgebildet werden und bei psychischen Störungen beeinträchtigt sind. Dazu gehört vorrangig die Verarbeitung von Bedrohung, Frustration und Provokation, das Ärgererleben und kognitive Kontrollprozesse dieser emotionalen Reaktionen.
Welche spezifischen Aspekte von Aggressionen untersucht der neue Bereich?
Prof. Habel: Wir untersuchen Aggression sehr breit, also zum Beispiel von verbaler bis physischer Aggression, in Form von Mobbing, als soziale, aber auch nicht-soziale Aggression und als reaktives oder instrumentelles aggressives Verhalten. Reaktive Aggression, die bei psychischen Störungen sicher die häufigste Form darstellt, entsteht durch eine Bedrohung, Frustration oder Provokation und ist meist mit Ärger verbunden, während instrumentelle Aggression eher kalkuliert, absichtsvoll und zielgerichtet ist. Spezifisch schauen wir uns die biologischen Merkmale der verschiedenen Formen und die situativen Veränderungen an und beziehen weitere Krankheitssymptome von Patienten mit ein.
Wie definieren Sie in Ihrer Forschung Aggression und welche Mechanismen betrachten Sie als verantwortliche Treiber?
Prof. Habel: Aggression ist ein komplexes Konstrukt, entsprechend existieren viele verschiedene Definitionen. Eine, auf die man sich im Wesentlichen geeinigt hat, die auch wir zugrunde legen, ist die, dass Aggression ein Verhalten darstellt, das darauf ausgerichtet ist, einer Person Schaden zuzufügen, die wiederum bestrebt ist, diesen zu vermeiden. Hierbei kann das Verhalten verbal oder physisch sein.
Unter den Mechanismen sind genetische Faktoren, hormonelle und molekulare, aber eben auch kognitiv emotionale Prozesse und ihre neuronalen Korrelate im Gehirn. All diese Faktoren und ihr Zusammenspiel im Entstehen von Ärger und Aggression betrachten wir in den Einzelprojekten unseres Verbundes. In einer Kohorte, die wir im Längsschnitt untersuchen, verfolgen wir über die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen, wie sich aggressives Verhalten verändert und wie es mit der Symptomatik der psychischen Erkrankung zusammenhängt. Zudem betrachten wir natürlich weitere Einflussfaktoren, wie den Kontext, die dynamischen Veränderungen einer Situation oder den Krankheitsverlauf.
Wie sieht Aggression bei gesunden sowie psychisch gestörten Personen aus?
Prof. Habel: Das ist Teil unserer Forschungsfrage, das wissen wir nicht genau, vermutlich sind sehr ähnliche neuronale Mechanismen involviert, aber wir wissen nicht welche genauen qualitativen und quantitativen Veränderungen bei Patienten im Rahmen ihrer Dysfunktionen vorliegen und aggressives Verhalten begünstigen und ob diese Mechanismen krankheitsspezifisch oder unspezifisch sind. Es gibt Hinweise darauf, dass Aggression gemeinsam mit weiteren Krankheitsmerkmalen vermehrt auftritt. Dies könnte auf einen biologischen Mechanismus hindeuten, der allgemein Störungen emotionaler und kognitiver Prozesse verstärkt.
Wie hängen Gewalterfahrungen und gewalttätiges Verhalten zusammen?
Prof. Habel: Hier gibt es einen recht engen Bezug. Wir können hier anhand eigener Daten Aussagen machen. Es sind spannende Ergebnisse aus Patientenbefragungen. Zunächst haben wir eine Befragung in der gesamten Uniklinik RWTH Aachen durchgeführt. Dann haben wir das noch einmal auf andere Kliniken ausgedehnt. Wir haben insgesamt Daten von mehr als 5.000 Patientinnen und Patienten erhoben. Und tatsächlich: Eigene Gewalterfahrung, ob physischer oder psychischer Art, ist der beste Prädiktor für späteres aggressives Verhalten. Das war zwar keine Befragung der Allgemeinbevölkerung, aber sie deckte ein wirklich breites Spektrum an Patienten sehr verschiedener Kliniken, von der Gynäkologie bis zur Psychiatrie ab. Wir erfassen diesen Zusammenhang zwischen Opfererfahrungen beziehungsweise aversiven Kindheitserfahrungen und der späteren Ausübung von Aggression und Gewalt bei Patienten mit psychischen Erkrankungen auch in dem aktuellen Verbundprojekt.
Welche Netzwerke sind in unserem Gehirn beteiligt und lassen sich diese per Bildgebung darstellen?
Prof. Habel: Es sind verschiedene Netzwerke und Transmittersysteme beteiligt, aber im Fokus stehen die Verbindungen vom emotional-limbischen System, das tief liegende, evolutionär alte Gehirnstrukturen mit einschließt, wie zum Beispiel die Amygdala und frontale Hirnareale, die besonders für die Kontrolle von Emotionen und Verhalten zuständig sind. Diese limbisch-frontalen Verbindungen scheinen im Falle von pathologischer Aggression verändert.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Prof. Habel: Ja, die gibt es. Das Geschlecht hat auf viele Bereiche unseres Lebens großen Einfluss: Verhalten, Erleben, aber auch Gesundheit. Viele psychische Störungen haben bei Männern und Frauen unterschiedliche Prävalenzen. Hier wirken Geschlechtseinflüsse und wir verstehen noch nicht ausreichend, welche genauen Mechanismen diesen Geschlechtsunterschieden zugrunde liegen. Im Bereich Aggression lässt sich sagen, dass Männer vor allem physisch aggressiver sind und mehr kriminelle Gewalttaten begehen. Aber was spannend ist: Wenn man im Experiment Frauen genauso provoziert wie Männer, nähert sich, mit zunehmender Provokation, das Verhalten an. Dann sehen wir keine Geschlechtsunterschiede. Hier kommen vermutlich Geschlechtsstereotype und soziale Erwartungen zum Tragen. Und wenn man versucht, diese so gering wie möglich zu halten, indem man zum Beispiel Situationen so gestaltet, dass keine Erwartungen an geschlechtsrollenorientiertes Verhalten geweckt werden, dann verschwinden Geschlechtsunterschiede manchmal. Allerdings muss man hier auch experimentellen Kontext und Verhalten in der Realität differenzieren. Im einen Fall sprechen wir von der Realität, im anderen von einem künstlichen experimentellen Setting, das ist nicht eins zu eins übertragbar.
Wie kann man aggressives Verhalten reduzieren?
Prof. Habel: Auch hier geht man üblicherweise mehrgleisig vor, mit psychotherapeutischen und medikamentösen Interventionen. Bisherige Versuche waren sowohl psychotherapeutisch als auch medikamentös nur sehr begrenzt erfolgreich zur Reduktion von Aggression, und die Evidenz ist auch aufgrund methodischer Probleme der Studien sehr eingeschränkt. Wir arbeiten an einer Optimierung dieser Methoden durch ein besseres Verständnis der Mechanismen von Aggression. Es gibt hier schon im Rahmen unseres Verbundes erste Erfahrungen und Expertise in der Mechanismen basierten Psychotherapie wie auch mit den verschiedenen nicht-invasiven Stimulationsverfahren oder dem Neurofeedback, die man zusätzlich zu Psychotherapie oder medikamentösen Behandlung einsetzen könnte. Bei nicht-invasiven Hirnstimulationen, wie der transkraniellen Magnetstimulation oder der transkraniellen Gleichstromstimulation, ist das Ziel, die beteiligten Hirnnetzwerke und damit kognitive Prozesse zu beeinflussen. Bei letzterer wird ein schwacher, kontinuierlicher Gleichstrom eingesetzt, der über Elektroden auf die Kopfhaut aufgetragen wird. Bei ersterer werden sich rasch ändernde Magnetfelder über bestimmte Hirnregionen induziert. Im Rahmen von Neurofeedback wiederum lernen Patienten, die Kontrolle über ihre eigenen Hirnaktivität zu erlangen. Dies versuchen wir im Rahmen des Projektes weiterzuentwickeln und zu spezifizieren basierend auf unseren Erkenntnissen zu den Mechanismen.
Welche Techniken oder Methoden werden in Ihrer Forschung eingesetzt?
Prof. Habel: Wir benutzen sehr viele verschiedene Methoden und Techniken, um uns diesem komplexen Phänomen zu nähern. Im Humanexperiment erfassen wir die verschiedenen genannten Ebenen, also bestimmen genetische Faktoren über Blutproben, hormonelle Einflüsse über Speichelproben. Aber wir halten natürlich vor allem Verhalten und die Hirnaktivierung mittels verschiedener bildgebender nicht-invasiver Verfahren fest, darunter funktionelle Magnetresonanztomographie und Elektroenzephalographie. Wir verwenden Fragebögen und klinische Beurteilungsinstrumente und wir versuchen mittels standardisierter Paradigmen Aggression im Experiment zu erfassen. Dabei messen wir zum Beispiel die Hirnaktivität und -konnektivität, aber auch was im Körper physiologisch oder hormonell vor sich geht. Und natürlich versuchen wir, das Verhalten mit dem Alltag zu verbinden. Wir setzen beispielsweise Handy-Apps ein, um aggressive Ereignisse oder Ärgererleben im Alltag zu dokumentieren.
Welches Ziel verfolgen Sie mit der klinischen Aggressionsforschung?
Prof. Habel: Wir versuchen das komplexe Konstrukt Aggression bezüglich seiner zugrunde liegenden Mechanismen und Einflussfaktoren im Kontext von psychischen Störungen besser zu verstehen. Wir nehmen an, dass es Biosignaturen gibt, also Muster verschiedener relevanter Prozesse oder Faktoren, die krankheitsübergreifend zum Tragen kommen und mit bestimmten Symptomen assoziiert sein können – was präventiv und behandlungsbezogen relevant wäre. Wenn es weniger störungsspezifische Mechanismen sind, die wir bislang vor allem untersucht haben, könnten wir mit diesem Wissen besser personalisiert abgestimmte Behandlungen entwickeln. Mit diesem verbesserten mechanistischen Verständnis, so glauben wir, können wir Prädiktion, Prävention und Behandlung aggressiven Verhaltens bei Patienten zielgerichteter. ![]()
⇒ Hören Sie auch den Podcast Faszination „Neurobio- und Neuropsychobiologie“ mit Prof. Habel.