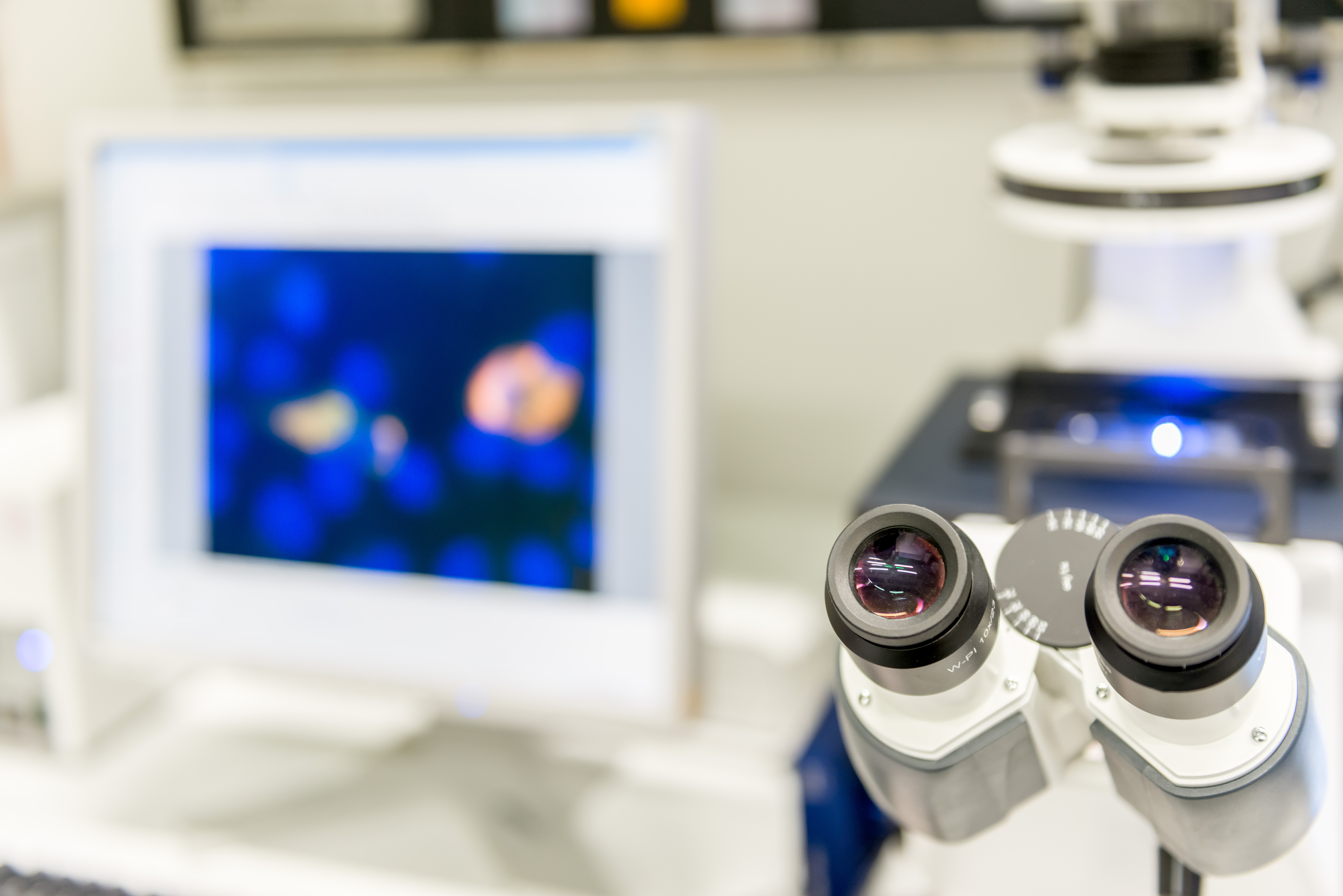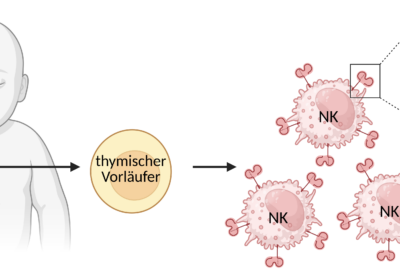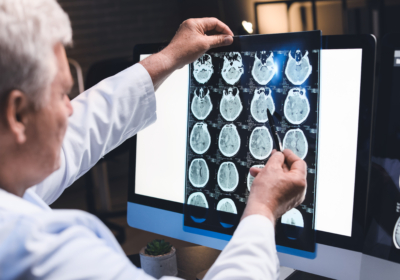Dr. phil. Michael Kursawe
Herr Dr. Kursawe, Sie arbeiten im Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen und erforschen dort Perzeptionsschwellen. Bitte erklären Sie kurz, was man unter Perzeptionsschwellen versteht.
Dr. Kursawe: Die Perzeption, also der Vorgang der Wahrnehmung, ist zunächst sehr universell und bezieht sich auf alle Sinne, wie zum Beispiel das Hören, Sehen oder Tasten. Dabei tritt immer ein physikalisch messbarer Reiz auf, den wir mit unseren Sinnen erfassen können. Es gibt allerdings Reizintensitäten, die so schwach sind, dass wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Beispielsweise muss ein Geräusch eine bestimmte Intensität erreichen, damit wir es hören können. Erreicht es diese Intensität, befinden wir uns an der Perzeptionsschwelle, also dem Übergang vom Zustand keiner Wahrnehmung zum Zustand einer erfolgreichen Wahrnehmung. Diese Schwelle ist individuell unterschiedlich und hängt von persönlichen Eigenschaften wie dem Hörvermögen oder der Fähigkeit zur Konzentration ab. In unserem Labor beschäftigen wir uns mit dem Tastsinn und genauer mit der Frage, ab wann, wie und unter welchen Umständen Menschen elektrische Felder, wie sie im Bereich von Hochspannungsleitungen auftreten, wahrnehmen können.
Warum ist es so wichtig, Perzeptionsschwellen zu erforschen?
Dr. Kursawe: Der durch die Energiewende erforderliche Ausbau des Höchstspannungsnetzes beinhaltet auch die in Deutschland neu eingeführte Hochspannungsgleichstromübertragung. Im Speziellen findet vereinzelt eine Kombination bereits existierender Wechselstromübertragung mit Gleichstromübertragung statt, woraus elektrische Hybrid-Felder entstehen. In Deutschland existiert für elektrische Felder im Bereich der Hochspannungswechselstromübertragung ein Grenzwert von 5 Kilovolt pro Meter (kV/m), der unterhalb einer Leitung nicht überschritten werden darf. Für Gleichspannungs- oder Hybrid-Felder gibt es dagegen keine Grenzwerte. Die Wahrnehmung der bei der Energieübertragung entstehenden Felder ist ein wesentlicher Faktor und maßgeblich für die Akzeptanz in der Bevölkerung. Da es im Bereich der Wahrnehmung elektrischer Gleichspannungs- und Hybrid-Felder keine stabile Datenbasis gab, existierte hier Forschungsbedarf, um abzuschätzen, ab wann Wahrnehmung überhaupt stattfindet.
Wie lassen sich Perzeptionsschwellen erforschen?
Dr. Kursawe: Eine einfache Methode wäre, Personen Reize in steigender Intensität zu präsentieren und jedes Mal zu fragen, ob der Reiz wahrgenommen werden kann. Wenn in dieser Methode eine Person zum Beispiel immer mit „ja“ antwortet, sieht es so aus, als würden alle Reize wahrgenommen. Ob dies allerdings stimmt, kann nicht überprüft werden. Deshalb werden Reize mit sogenannten Scheinexpositionen gemischt präsentiert. In einer Scheinexposition ist kein Reiz vorhanden und dies muss von der Person ebenfalls korrekt erkannt werden. Antwortet in dieser Testreihe eine Person immer mit ja, kann dies als persönliche Tendenz erkannt werden. Die individuelle Wahrnehmungsschwelle kann aus einer Testreihe, in der reale und Scheinexpositionen gemischt in zufälliger Reihenfolge auftreten, aus den Antworten auf die Reize unterschiedlicher Intensität berechnet werden.
Im Rahmen einer groß angelegten Studie mit über 200 Probandinnen und Probanden haben Sie Wahrnehmungsschwellen für elektrische Gleichfelder (DC) und elektrische Wechselfelder (AC) auch unter dem Einfluss einer veränderten Luftfeuchtigkeit bestimmt. Wie sind Sie dabei vorgegangen, was war die Methodik?
Dr. Kursawe: In dieser Studie haben wir 203 gesunde Personen untersucht, die in vier Altersklassen zwischen 20 und 80 Jahren gleichverteilt, sowie hälftig weiblich und männlich waren. Diese wurden mit Wechselspannungsfeldern (engl. Alternating Current, AC), Gleichspannungsfeldern (engl. Direct Current, DC), sowie einer Kombination aus beiden, den sogenannten Hybrid-Feldern exponiert. Zusätzlich wurde bei einem Teil der Personen die relative Luftfeuchtigkeit im Labor von 50 Prozent auf 70 Prozent bzw. auf 30 Prozent variiert. Methodisch haben wir uns an der Signalentdeckungstheorie orientiert, deren zentrales Element die Durchmischung von Schein- und realen Expositionen ist. Dabei wurden für jede Feldart vier bis fünf verschiedene Intensitäten angeboten, die einen großen Bereich abdecken. Aus Voruntersuchungen wussten wir, wie dieser Bereich ungefähr aussehen muss. Die Annahme war daher, dass die Wahrnehmungsschwelle in dieser Spanne zu finden sein würde.
Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?
Dr. Kursawe: Zunächst haben wir festgestellt, dass alle Personen elektrische Felder erfolgreich wahrgenommen haben. Die Perzeptionsschwellen lagen für AC-Felder bei 14,2 kV/m und für DC-Felder bei 18,7 kV/m. Wirklich spannend war die Erkenntnis, dass wir hinsichtlich der Hybrid-Felder eine Perzeptionsschwelle von 6,8 kV/m DC gefunden haben, während ein konstantes AC-Feld von 4 kV/m präsent war. Obwohl wir erwartet haben, das Menschen Hybrid-Felder besser wahrnehmen können, war das Ausmaß dieses Unterschieds überraschend. Dabei konnten etwa 40 Prozent der Teilnehmenden die niedrigste von uns getestete Kombination von 2 kV/m DC und 4 kV/m AC erfolgreich wahrnehmen. Dieser Synergieeffekt beider Feldarten auf die menschliche Wahrnehmung war Gegenstand weiterer Forschungsprojekte, in denen wir zeigen konnten, dass sowohl der AC-Anteil als auch der DC-Anteil signifikant für die gute Wahrnehmbarkeit verantwortlich sind. Weiterhin war der Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig von der Feldart: Hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigte die Wahrnehmung von elektrischen DC-Feldern, relativ trockene Luft begünstigte die Wahrnehmung von elektrischen AC-Feldern. Diese Erkenntnis ist wichtig für die Übertragung in die Umwelt, da draußen über das Jahr hinweg sehr unterschiedliche Bedingungen herrschen, die einen Einfluss auf die Wahrnehmung der elektrischen Felder haben.
Können Sie beschreiben, wie sich ein elektrisches Feld anfühlt?
Dr. Kursawe: Wir haben diese Frage unseren Testpersonen gestellt und die häufigsten Antworten waren „angenehmes Kribbeln“, „leichtes Jucken“, „wie Gänsehaut“ oder eine „leichte Vibration“. Insgesamt kann auch ein kühlender Eindruck oder der eines leichten Lufthauchs entstehen. In weitaus geringerem Maße gaben Personen auch unangenehme Empfindungen wie „unangenehmes Brennen“ oder „unangenehmes Stechen“ an. Insgesamt wurden DC-Felder vermehrt im Kopfbereich, AC-Felder mit leichtem Fokus auf den Armbereich wahrgenommen. Wir können trotzdem festhalten, dass Qualität und Lokalität individuell sehr unterschiedlich sind.
Sie arbeiten in einem Perzeptionsschwellenlabor. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Labor aufgebaut, welche Technik ist vorhanden?
Dr. Kursawe: Kern des Labors ist ein etwa 4 x 4 Meter großer Raum, in dem mittig ein Stuhl installiert ist, auf dem Personen sitzend mit elektrischen Feldern exponiert werden können. Angrenzend befindet sich ein Raum, der die Hochspannungstechnik beinhaltet, sowie ein Raum, in dem sich die Versuchsleitung befindet. Die zentralen Räumlichkeiten sind gänzlich aus Holz gebaut, um die Leitfähigkeit so gering wie möglich zu halten. Zur Durchführung experimenteller Testungen sind neben der Testperson immer zwei Personen erforderlich: eine Versuchsleitung zur Überwachung und Kommunikation mit der Testperson sowie ein Techniker zur Überwachung der Hochspannungsanlage. In einem weiteren Bereich befindet sich die Klimatechnik, die jederzeit eine konstante Umgebungsbedingung im Testraum garantiert. Ein Kernelement des Labors besteht in der doppelblinden Versuchsanordnung. Weder die Versuchsleitung noch die Testperson erhalten Informationen über den aktuellen Status des Experimentes. So ist nicht erkenntlich, ob gerade eine Scheinexposition oder eine reale Exposition stattfindet. Die Experimente laufen automatisiert, und die einzelnen Durchgänge in randomisierter Reihenfolge ab. Dabei wird der Testperson immer wieder die Frage eingeblendet, ob sie ein elektrisches Feld wahrnimmt. Sie kann dann per Tastendruck angeben, ob ein elektrisches Feld ihrer Meinung nach vorhanden ist oder nicht.
Gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen in diesem Labor?
Dr. Kursawe: Es gibt eine ganze Reihe von Sicherheitseinrichtungen, die alle den Schutz der beteiligten Personen zum Ziel haben. Da für die Erzeugung der elektrischen Felder hohe Spannungen benötigt werden, existiert im Testraum ein sicherer Bereich, der von Lichtschranken umgeben ist. Wird an einer Stelle eine dieser Lichtschranken unterbrochen, schaltet die Anlage automatisch in einen sicheren Zustand und wird geerdet. Dies geschieht sehr schnell, sodass ein Kontakt mit spannungstragenden Teilen ausgeschlossen ist. Die speicherprogrammierbare Steuerung, die den Kern des Sicherheitssystems darstellt, überwacht insgesamt eine Vielzahl von Parametern im Gebäude, wie beispielsweise die Türen oder die Höhe der anliegenden Spannungen und überführt bei kleinsten Abweichungen die Anlage in einen Sicheren Zustand. Da alle sicherheitsrelevanten Komponenten redundant ausgelegt sind, ist so auch bei Ausfall einer Komponente immer die Funktionsfähigkeit garantiert.
Sind weitere Studien in Planung und falls ja, können Sie bereits jetzt mehr dazu sagen?
Dr. Kursawe: Wir haben uns nach der Durchführung mehrerer Projekte zu Perzeptionsschwellen vor allem mit Blick auf die Wahrnehmung von Hybrid-Feldern mit den Wirkmechanismen beschäftigt, insbesondere mit der Rolle der Haare beim Vorgang der Wahrnehmung. Dafür haben wir Personen mit verschiedenen elektrischen Feldern exponiert und vor einer erneuten Testung Kopf- und Armhaare entfernen lassen. Erste Ergebnisse hierzu sind vielversprechend und deuten darauf hin, dass Haare ganz entscheidend für die Wahrnehmung elektrischer Felder sind. Aktuell sind wir in der Startphase eines gerade bewilligten Projektes, in dem wir uns auf Personen fokussieren, die an selbstberichteter Elektrosensibilität leiden. Geplant ist die Untersuchung von insgesamt 150 Personen, 50 Personen mit hoher Sensitivität, 50 Personen niedriger Sensitivität gegenüber elektrischen Feldern und 50 Personen mit selbstberichteter Elektrosensibilität. Ziel des Vorhabens ist es, die elektrosensiblen Personen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Wahrnehmung elektrischer Felder einzuordnen sowie eine umfassende Betrachtung aller getesteten Personen vorzunehmen.
Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft wagen: Wie wird sich Ihr Forschungsbereich in den nächsten Jahren entwickeln?
Dr. Kursawe: Das Thema der Perzeption elektrischer Felder hat zunächst eine hohe Relevanz im Kontext der uns begleitenden Energiewende. Dafür sind die Erkenntnisse ein wichtiger Beitrag mit Blick auf den Einfluss elektrischer Felder der Hochspannungsübertragung auf das bewusste Empfinden der Menschen. Neben dieser praktischen Relevanz ist auf Grundlagenebene eine spannende Frage, wie der exakte Mechanismus der Wahrnehmung funktioniert. Wir haben hier erste Hinweise auf die Rolle der Behaarung. Es bleiben allerdings auch viele Fragen offen, zum Beispiel wie es von einer Wirkung auf das Haar auf Zellebene weitergeht. Denkbar sind zudem auch Forschungsfragen im Kontext spezieller Personengruppen wie Schmerzpatienten, um hier potenzielle Interaktionen zu untersuchen.
Sie sind Diplom-Psychologe. Wie entwickelte sich Ihr Interesse für das Thema Perzeptionsschwellen?
Dr. Kursawe: Ich habe mich als Wissenschaftler schon immer sehr dafür interessiert, wie und warum Dinge zwischen dem Menschen und seiner Umwelt funktionieren und welche Auswirkungen äußere Einflüsse auf unser Erleben und die dahinterliegenden kognitiven Funktionen haben. Zum Thema der Perzeptionsschwellen elektrischer Felder bin ich vor einigen Jahren eher zufällig gekommen. Seitdem entstehen allerdings ständig neue Fragen, die in weiteren Projekten beantwortet werden wollen und die meine anfängliche Neugierde weiter wachsen lassen. Mir gefällt zudem der stark interdisziplinäre Bezug zwischen Medizin, Elektrotechnik, Biologie und Psychologie, der die Durchführung unserer Studien erst möglich macht. ![]()