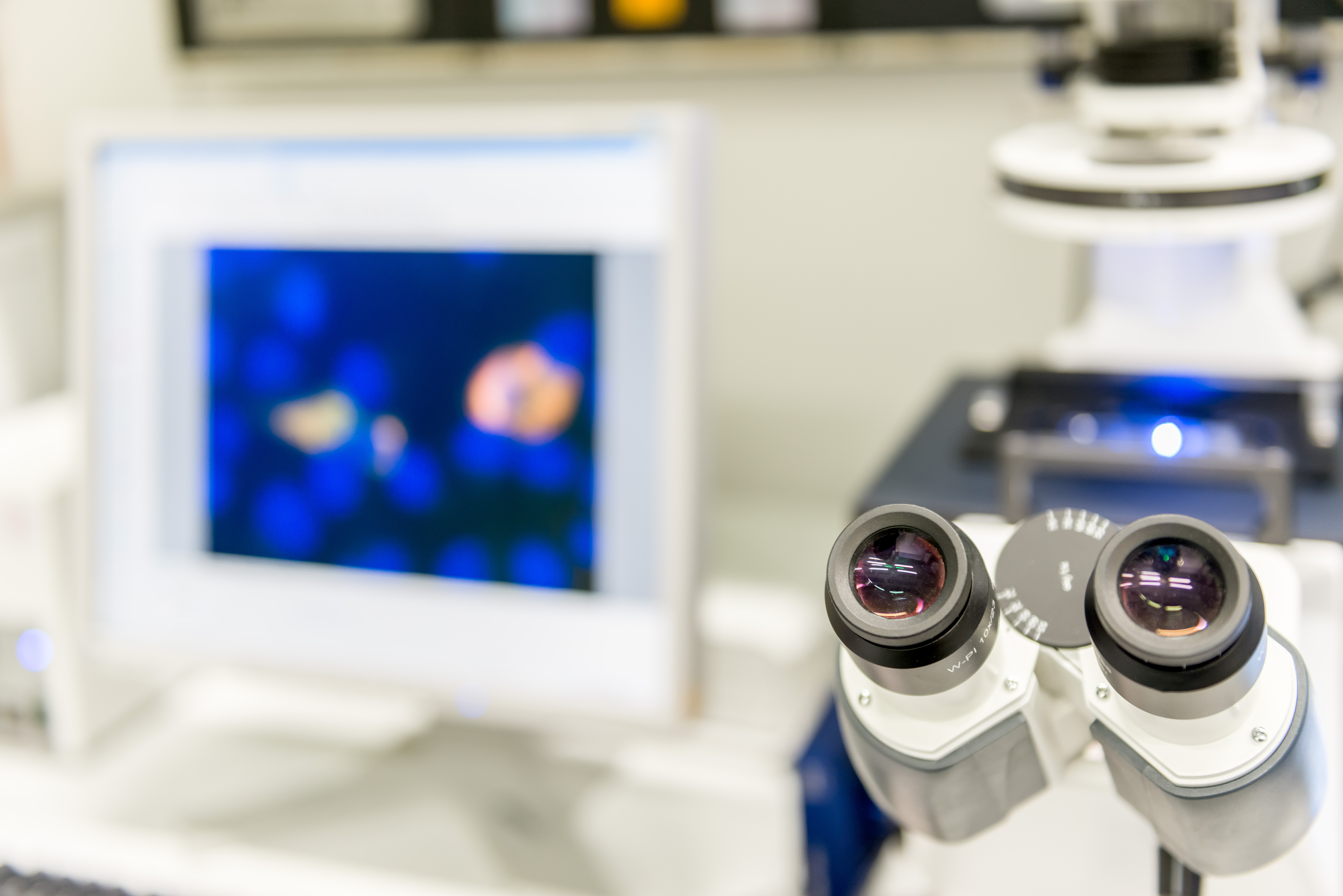In der Mikrobiomforschung sind Mausmodelle und deren Bakterienstämme der Schlüssel für ein besseres Verständnis der Einflüsse von Darmbakterien auf die Gesundheit. Jedoch ist bislang nur ein Bruchteil der Darmmikroben vollcharakterisiert und öffentlich verfügbar. Unter Federführung von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas Clavel ist es Forscherinnen und Forschern der Arbeitsgruppe „Funktionelle Mikrobiomforschung“ innerhalb des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Uniklinik RWTH Aachen gelungen, eine öffentlich zugängliche Bakteriensammlung aus dem Mausdarm substantiell zu erweitern. Diese Sammlung ermöglicht die metagenomgestützte Vorhersage synthetischer Gemeinschaften (SYNs), die wichtige funktionelle Unterschiede zwischen Mikrobiomen erfassen. Die wegweisende Studie ist nun im renommierten Fachjournal Cell Host & Microbe erschienen.
Milliarden von mikroskopisch kleinen Mikroorganismen leben vor allem im Darm, aber auch auf der Haut sowie anderen Körperregionen mit dem Menschen – und Säugetieren im Allgemeinen – in Symbiose. Die Gesamtheit aller rund 100 Billionen Mikroorganismen bezeichnen Expertinnen und Experten auch als Darmmikrobiota. Die überwiegend aus Bakterien, Viren und Pilzen bestehenden Mikroorganismen beeinflussen die Gesundheit des Wirts. „Da die Bakterien im Darm große Auswirkungen auf die Physiologie haben, ist es wichtig, ihre Vielfalt und Funktionen zu untersuchen und zu verstehen“, so Prof. Clavel, der die Forschungsgruppe leitet.
Neue Bakterienstämme aus Mausmikrobiom entschlüsselt
In der Grundlagen- und klinischen Forschung führen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige Analysen anhand von Mausmodellen durch. Da Mäuse eine äußerst komplexe Zusammensetzung ihrer Darmmikrobiota, ähnlich der des Menschen, aufweisen, die aus Tausenden von bakteriellen Taxa besteht, kann die Darmmikrobiota der Maus die Forschungsergebnisse erheblich beeinflussen. Allerdings liegt nach wie vor über viele Darmbakterien nicht genug Wissen vor. Trotz der Arbeiten der letzten fünf Jahre auf diesem Gebiet ist die Vielfalt der bislang nicht kultivierten Bakterien immer noch groß, was weitere Fortschritte auf diesem Gebiet behindert: „Eine erhebliche Herausforderung ist der große Anteil an unbekannten mikrobiellen Genen und entsprechenden Taxa, der sowohl molekulare als auch experimentelle Studien einschränkt. Viele Bakterienarten sind entweder unbeschrieben oder in internationalen Kulturrepositorien nicht verfügbar“, erläutert Prof. Clavel die Ausgangslage seiner Forschungsarbeit.
Dem Aachener Forschungsteam ist es nun gelungen, die Bakteriensammlung aus dem Mausdarm (www.dsmz.de/miBC) auf 212 Stämme zu erweitern, die alle öffentlich zugänglich und taxonomisch beschrieben sind. Die Sammlung enthält mehrere neue Arten in wichtigen Bakteriengruppen wie den Muribaculaceae, Coriobacteriales oder Clostridiales. In der veröffentlichten Studie wurden 39 neue Taxa vollständig beschrieben, darunter eine neue Familie, die durch kleine Bakterien vertreten ist. Zudem konnten Experimente zeigen, dass bestimmte Bakterienarten eine direkte Rolle bei der Modulation von Immunantworten spielen und neue Wege für studienspezifische synthetische Gemeinschaften (SYNs) von Darmbakterien der Maus eröffnen. „Diese Sammlung ermöglicht die metagenomgestützte Vorhersage synthetischer Gemeinschaften, die wichtige funktionelle Unterschiede zwischen Mikrobiomen erfassen“, erläutert Prof. Clavel die Ergebnisse. Zusätzlich wurden neun Spezies verwendet, um das Oligo-Mouse Microbiota (OMM)12-Modell zu ergänzen, wodurch das OMM19.1-Modell entstand. Für künftige Studien stehen gebrauchsfertige OMM-Stämme zur Verfügung. Das verbesserte Wissen über die Vielfalt der Darmmikrobiota in Mäusen ermöglicht durch die modulare Verwendung von Isolaten funktionelle Studien. „Dadurch können Mausversuche zukünftig ein Stück vergleichbarer werden“, ergänzt der Mikrobiomforscher.
Der Aufbau von Bakteriensammlungen aus dem Darm auf dem neuesten Stand der Technik ist ein mühsames Unterfangen. „Das Ziel unserer Arbeit war es, der Entschlüsselung der in Mäusen kultivierbaren Darmbakterien ein Stück näherzukommen. Das ist uns geglückt und wir konnten detaillierte Informationen über neue Taxa bereitstellen, öffentlich zugänglich machen und damit einen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen. Es bleibt aber noch viel zu tun“, resümiert der Wissenschaftler.
Ergebnisse fließen in eine Datenbank
Die Datenbank über kultivierbare Bakterienarten und ihr genetisches Material im Mausmikrobiom ist öffentlich verfügbar (www.dsmz.de/miBC). Die dort bereitgestellten Ergebnisse sollen dazu beitragen, verlässlichere Schlussfolgerungen im Rahmen präklinischer Studien mittels Mausmodellen zu ziehen. Durch den freien, weltweiten Zugriff besteht die Hoffnung, den bislang unvollständigen Status zu vervollständigen und Wissenslücken über das Mikrobiom zu schließen, um so beispielsweise genetische Verwandtschaftsgrade überprüfen oder die Wechselwirkungen der verschiedenen Bakterienfamilien untereinander klären zu können.
„Die gesammelten Erkenntnisse sollen zum einen ein besseres Verständnis der Einflüsse von Darmbakterien auf die verwendeten Mausmodelle ermöglichen und zum anderen aufzeigen, wie man sich das menschliche Darmmikrobiom zunutze machen kann, um beispielsweise Infektionskrankheiten beim Menschen zu verhindern“, erläutert Prof. Clavel.
Forschungsgruppe „Funktionelle Mikrobiomforschung“ der Uniklinik RWTH Aachen
Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Clavel widmet sich der Erforschung des intestinalen Mikrobioms (der Gemeinschaften von Mikroorganismen, ihrer Genome und der Umweltfaktoren im Darm). Dabei konzentrieren sich die Forschenden in erster Linie auf die Darmmikrobiome von Mensch, Schwein und Maus, da sie für die Gesundheit von großer Bedeutung sind. Im Fokus steht hierbei die Beschreibung taxonomischer und funktioneller Vielfalt der Darmbakterien mithilfe von kulturbasierten und sequenzierenden Ansätzen. Die Verwendung von Isolaten unter standardisierten Bedingungen in kontinuierlichen Kultursystemen und gnotobiotischen Modellen hilft dabei, Mikroben-Mikroben- und Mikroben-Wirt-Interaktionen zu verstehen. Besonderes Interesse besteht in den spezifischen mikrobiellen Funktionen, die an den Interaktionen mit dem Wirt und Ernährungsfaktoren beteiligt sind, einschließlich der Umwandlung von Lipiden und der Auswirkungen auf die Darm- und Leberphysiologie.
Hauptkollaborationspartnerinnen und -partner:
- Dr. Bärbel Stecher, Ludwig-Maximilians-Universität München
- Dr. Till Strowig, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Braunschweig
- Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
Gefördert durch:
Die Publikation finden Sie hier. ![]()