Bereits lange ist klar, dass jeder Tumor durch genetische Veränderungen entsteht. Diese Veränderungen können in einer Zelle spontan auftreten, ohne dass es einen erkennbaren Auslöser oder eine Veranlagung für die Krebserkrankung gibt. Diese sogenannte sporadische Tumorentstehung wird für den größten Teil der Tumoren angenommen. Etwa zehn Prozent der Tumorerkrankungen sollen jedoch auf einer erblichen Veranlagung, einem sogenannten Tumorprädispositionssyndrom, beruhen. Hierbei hat eine betroffene Person durch eine ererbte genetische Veränderung bereits ein erhöhtes Tumorrisiko. Durch den Einsatz neuer genetischer Techniken der Genomsequenzierung, sogenannte Next-Generation-Sequencing (NGS) und Third-Generation-Sequencing (TGS) Methoden, wird immer mehr in Frage gestellt, ob der Anteil erblicher Tumorprädispositionen tatsächlich nur zehn Prozent ausmacht oder doch deutlich höher liegt. Insbesondere bei kindlichen Tumorerkrankungen weisen neuere Studien auf einen höheren Anteil erblicher Ursachen hin, deren Diagnosestellung nicht nur für die Therapie und weitere medizinische Betreuung der Patienten selbst, sondern auch für deren Familien präventiv-medizinisch große Bedeutung haben kann. Aus diesem Grund liefert die Erforschung von genetischen Prädispositionen für Tumoren einen entscheidenden Beitrag für das Verständnis von Tumorerkrankungen und die medizinische Begleitung betroffener Familien.
Eine Patientin aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen, Sektion pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Udo Kontny, hat mit ihrer Krankengeschichte nun entscheidend zur Identifikation eines neuen Tumorprädispositionssyndroms beigetragen. „Die Patientin zeigte im frühen Kleinkindalter einen hochmalignen Kleinhirntumor, ein sogenanntes Medulloblastom, und entwickelte im Verlauf eine Form des Hautkrebses im Bestrahlungsfeld sowie Darmpolypen“, wie Prof. Kontny mitteilte. Durch das immer wieder neue Auftreten von Tumoren wurde die Patientin zur weiteren Abklärung im Institut für Humangenetik an der Uniklinik RWTH Aachen unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth, mit dem Verdacht auf Vorliegen eines erblichen Tumorprädispositionssyndroms vorgestellt. Hieraus entwickelte sich ein gemeinsames Forschungsprojekt, das aktuell im Journal of Clinical Oncology publiziert wird.
Im Institut für Humangenetik erfolgte zunächst mittels Next-Generation-Sequencing eine Exom-Sequenzierung aus einer Blutprobe der Patientin. Hierbei werden alle Abschnitte der Erbsubstanz, die in Eiweiße übersetzt werden, auf angeborene genetische Veränderungen, sogenannte Keimbahnvarianten, untersucht und die entstehenden großen Datenmengen bioinformatisch prozessiert und beurteilt. „Bei der Patientin ließ sich eine bioinformatisch als krankheitsverursachend hervorgesagte Variante im GPR161-Gen nachweisen, das kürzlich bei Knockout-Mäusen in Verbindung mit der Entstehung von Medulloblastomen gebracht werden konnte“, so Dr. Matthias Begemann, der sich intensiv mit der Auswertung von Genomdaten beschäftigt und Erstautor der Studie ist. Für den letztendlichen Beweis, dass Mutationen im GPR161-Gen tatsächlich zur Tumorentstehung führen, waren jedoch weitere Bausteine notwendig. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Stefan Pfister am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sowie Dr. Sebastian Waszak am EMBL in Heidelberg konnten diese in einer großen Kohorte von Patienten mit Medulloblastomen weitere fünf Patienten mit pathogener GPR161-Keimbahnmutation identifizieren und somit entscheidend zum Beweis des GPR161-assoziierten Tumorsyndroms beitragen. Studien am Tumormaterial aller Patienten bestätigten einen einheitlichen Entstehungsmechanismus der Erkrankung: „Die Patienten tragen als Ausdruck ihrer genetischen Prädisposition in allen Körperzellen bereits eine defekte Genkopie des GPR161-Gens und der Tumor entsteht, wenn die andere Genkopie von GPR161 durch einen sogenannten „zweiten-Treffer“ ausgeschaltet wird“, so Dr. Miriam Elbracht, die als Oberärztin am Institut für Humangenetik mit weiteren Kolleginnen und Kollegen ebenfalls an der Studie beteiligt war. „Die Prädisposition wird statistisch an 50% der Nachkommen weitervererbt, bislang können wir aber noch nicht abschließend sagen, wie wahrscheinlich ein Anlageträger im Verlauf des Lebens an einem Tumor erkrankt“. Dies soll in Folgestudien weiter untersucht werden. Dem GPR161-Gen kommt somit zunächst die Rolle eines Tumorsuppressorgens zu und die Entstehung von Medulloblastomen erklärt sich durch die Funktion des Gens in der Entwicklung bestimmter neuronaler Zellpopulationen. Für das neue, GPR161-assoziierte Tumorprädispositionssyndrom ist das frühkindliche Auftreten von Medulloblastomen charakteristisch. Das möglicherweise breitere Tumorspektrum wird in den nächsten Jahren klarer werden.
Die Kenntnis genetischer Prädispositionen wird zukünftig Therapieentscheidungen und präventive Maßnahmen bei Anlageträgern maßgeblich beeinflussen, da sind sich Prof. Kontny und Prof. Kurth einig. Die Bedeutung der Genomsequenzierung und des interdisziplinären Zusammenwirkens von Kinderonkologen, Onkologen, klinischen Genetikern, Molekulargenetikern, Neuropathologen und Pathologen sowie der Austausch mit übergeordneten großen Studienregistern wird hierbei weiter zunehmen, um die signifikante Anzahl an Tumorprädispositionen aufzuklären. ![]()
Originalpublikation:
Germline GPR161 mutations predispose to pediatric medulloblastoma
Matthias Begemann1,*, Sebastian M. Waszak2,*, Giles W. Robinson3, Natalie Jäger4,5, Tanvi Sharma4,5, Cordula Knopp1, Florian Kraft1, Olga Moser6, Martin Mynarek7, Lea Guerrini-Rousseau8, Laurence Brugieres8, Pascale Varlet9, Torsten Pietsch10, Daniel C. Bowers11, Murali Chintagumpala12, Felix Sahm13, Jan O. Korbel2, Stefan Rutkowski7, Thomas Eggermann1, Amar Gajjar3, Paul Northcott14, Miriam Elbracht1, Stefan M. Pfister4,5,15,§, Udo Kontny6,§, Ingo Kurth1,§
These authors contributed equally to this work:
*shared first authors
§ shared last authors
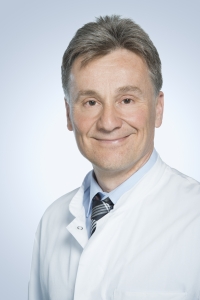
Univ.-Prof. Dr. med.
Udo Kontny

Univ.-Prof. Dr. med. Ingo Kurth






